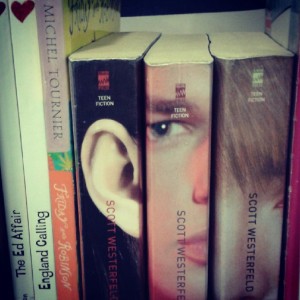Am 07.12.12 ging über Twitter, dass Sony die Produktion von Kassettenspielern einstellt. Ich weiß nicht, ob Sony der letzte Produzent der Magnetbandabspielgeräte war, aber als Manufaktur des legendären Walkmans löste diese Nachricht natürlich einen allgemeinen Abgesang aus, dem ich mich hier anschließen möchte.

Die Kassette trat im Oktober des Jahres 1991 in mein Leben. Nun, das ist natürlich nicht ganz richtig, meine Kindheit war geprägt von unzähligen TKKG-, „Drei Fragezeichen“- und Alf-Bändern. Aber in ihrer eigentlichen Bestimmungsform ließ die Kassette mich bis ins Jahr 1991 unbehelligt: dem Mixtape.
Dann trat sie aber um so krachender, nachhaltiger und prägender auf. Ich kann mich an das Datum noch so gut erinnern, da ich diese meine erste Kassette noch irgendwo hier habe, wenn ich sie auch nicht finden kann. Es ist der ‚Jaakko Mix 91‘. Die Mutter meines Schulfreundes hatte sich die Mühe gemacht, den eingeladenen Kindern als Abschiedsgeschenk nicht länger Gummibärchen, Luftballons oder billiges Plastikspielzeug mitzugeben, sondern eben ein Mixtape. Noch heute verbeuge ich mich im Respekt, wenn ich bedenke, dass sie das gleiche Tape erst zusammenstellen und dann noch ca. 10 Mal überspielen musste. Denn, liebe Postmagnetbandgeneration, ‚copy & paste‘ war nicht möglich bei der guten alten Kassette. Stattdessen musste man mit chirurgischer Präzision die Klaviatur der oftmals schwer zu drückenden Tasten ‚Play‘, ‚Record‘ und ‚Pause‘ beherrschen und dann live dabei sein, während das Band seine 30-45 Minuten Seitenlänge abspielte.
Ich war 1991 recht spät dran, viele meiner Freunde hatten sich schon 1989 auf dem ‚Wind of Change‘ tragen lassen und zwar in Richtung David Hasselhoff. ‚Looking for Freedom‘, ‚Crazy for you‘ und ‚Limbo Dance‘ waren die Hymnen unserer Präpubertät, immer wieder durchsetzt von den größten Klassikern der EAV. Nur war mein Elternhaus der klassischen Musik verfallen, sodass bei uns andächtig der ‚Zauberflöte‘ gelauscht wurde und nur aus dem Zimmer meines Bruders Depeche Mode drang, wozu ich aber bis heute noch keinen Zugang gefunden habe.
Der ‚Jaakko Mix 1991‘ jedenfalls glänzte durch Hammerhits von Dr. Alban, Seal und Roxette, um nur einige zu nennen. Ach, Roxette… Roxette hatte neben Bon Jovi und Brian Adams den größten Einfluss auf meine ersten Schritte ins Universum der Popmusik (Über schreckliche Euro-Dance-Vergehen zwischen ‚Mr. Vain‘ und ‚No Limit‘ breite ich hier den Mantel des Schweigens). So war auch die erste und – soweit ich mich erinnere – einzige Kassette, die ich mir je gekauft habe, von Roxette. Denn die Kassette war nicht zum kaufen geschaffen. Oder doch: man kaufte Leerkassetten um diese dann mit den Schätzen seiner Freunde zu füllen. Oder mit solchen aus dem Radio. Ach ja, das Radio: die Qual der Liveaufnahme. Drei bis fünf Minuten lang vor Angst schwitzen, ob denn der Moderator am Ende des Songs reinquatscht oder fast noch schlimmer: in ein anderes Lied überblendet. So war auch schnell klar, wo ich mich jeden Donnerstagabend einzufinden hatte: vor dem Apparat, wenn die hr3-Hitparade lief, der Garant dafür, dass Lieder ausgespielt und nicht vorzeitig unterbrochen wurden. Dort erfuhr ich, dass Meat Loaf alles für die Liebe tun würde außer „DAS“! – Was ich natürlich nicht verstand (Es geht da um Sex, oder?). Und dass Lauryn Hill von Worten sanft getötet wurde, während ihr Wycleff Jean noch dicke Beats unterschob.
Die Kassette hatte einen langen und langsamen Niedergang in meinem Leben. Zunächst sah alles prächtig für sie aus: der einfache Spieler wurde durch ein Doppelkassettendeck ersetzt, was die unsägliche Radioliveaunahme epochal vereinfache:. Erst die ganze Sendung aufnehmen und dann zurechtschneiden. Der Walkman – der echte(!) von Sony(!!) – fand seinen Weg zu mir und bescherte mir zahlreiche Wiedergaben von „Love is all around me“, mein Bruder zog aus und hinterließ mir seine Kassettensammlung sodass sich mein musikalischer Horizont über das Programm der Formatradios hinaus erweitern konnte. Schließlich kaufte ich mir vom Ersparten sogar einen Player, der Schnick Schnack beherrschte wie zum nächsten Lied vorspulen und Repeat-A-B. ‚Father and Son‘, ‚Sie ist weg‘ und ‚In The Ghetto‘ konnten so in Endlosschleifen laufen.
Doch der CD-Player machte auch vor mir nicht halt: Weihnachten 1993 schon bekam ich den ersten geschenkt zusammen mit einer David-Hasselhoff-CD, ach Elten, vier Jahre zu spät! „Das Gegenteil von gut ist gut gemeint“ (Kettcar). Ende der 90er kam dann noch die Minidisc hinzu. Mein Bruder hatte mich zwar gewarnt, dass sie sich nicht durchsetzen werde, aber ich konnte mich der Fusion aus Tape und CD nicht entziehen. Und ich bin noch heute der Meinung, dass sie hätte groß werden können, wenn das Janusköpfige Haus Sony nicht Elektronikkonzern und Musiklabel in einem gewesen wäre und als letzteres einen Kampf gegen die Windmühle der mp3 geführt hätte.
Einen kurzen zweiten Frühling erlebte die Kassette bei mir noch einmal um die Jahrtausendwende, als ich für mein erstes Auto ein gebrauchtes Kassettendeck erwarb und einbaute. Alte Tapes wurden mit neuen Stücken überspielt, zumeist mit deutschem Hip Hop zwischen Freundeskreis und den Beginnern. Ich weiß noch, wie sich eine Klassenkameradin kurz vor dem Abi meinen Wagen lieh und mir etwas verstört die Schlüssel wieder aushändigte, weil am Ende eines Tapes ein alter Track von Marc Oh wieder hervorgespäht hatte.
Doch dann kamen das Internet, das Studium, der Indie und die MP3 und es war aus mit dem Tape. Einmal bäumte sich die Kassette noch auf, als ich 2003 so sehr in die Breite gewachsen war, dass ich zu Joggen anfing und meinen alten Walkman wieder hervorkramte. Leider war es ein kurzes Vergnügen, der Gute ging in die ewigen Jagdgründe ein und ich musste im Elektronikmarkt feststellen, dass MP3-Player mittlerweile günstiger waren als ein neuer Walkman.
Nirvana — Smells Like Teen Spirit – MyVideo
Die Kassetten habe ich freilich aufgehoben aus reiner Nostalgie. 2006 habe ich auf dem Flohmarkt sogar noch einmal einen Kassettenplayer gekauft. Der steht jetzt im Zimmer meiner Tochter. Und wird nie benutzt. Aber irgendwann! Eines Tages hole ich die Kiste mit den Tapes noch einmal hervor und werde noch ein letztes Mal ‚Smells Like Teen Spirit‘ vom verrauschten Tape hören in unheiliger Kombination mit ‚November Rain‘ und gefolgt von ‚I can’t dance’…
Ich bin raus.